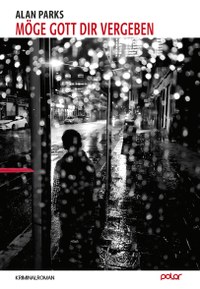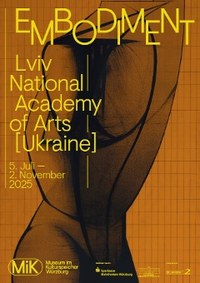Von Menschen und Mensch*innen heißt ein Buch, das dieser Tage im Springer-Wissenschaftsverlag erschienen ist – just zu dem Thema, zu dem fast alles schon gesagt ist. Aber eben lange nicht so analytisch und unterhaltsam wie von Fabian Payr.
Etwa hier: Wie gendert man eigentlich das Grundgesetz? Da heißt es in Artikel 3, Absatz 3: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Was gibt es daran zu ändern? Vom Rassebegriff einmal abgesehen? Das Pronomen „niemand“ verlangt nun einmal nach dem generischen Maskulinum, ebenso wie „jemand“, „man“ oder „wer“. Beispiel: Wer hat sein Buch in der Bibliothek vergessen? Payr schreibt dazu: „Es ist schwer nachzuvollziehen, warum auch diese Pronomina im Verdacht stehen, das Patriarchat zu zementieren, versteht sie doch jeder und jede unmittelbar als geschlechtsneutral.“ Zum generischen oder inklusiven Maskulinum gibt es oft keine sinnvolle Alternative. Etwa: „Angela Merkel ist der achte Bundeskanzler seit Gründung der Bundesrepublik.“ Das Wort „Bundeskanzler“ ist in diesem Kontext unmarkiert und damit im grammatischen Sinne geschlechtsneutral. Dass sich heute mehr Mädchen und Frauen vorstellen können, eines Tages Kanzlerin zu werden, als noch in den Achtzigerjahren, hat mit dem künstlichen Sprachumbau nichts zu tun, sondern schlicht mit Angela Merkel als Vorbild.
Sprache hat die Aufgabe, Wirklichkeit abzubilden. Und zur Wirklichkeit gehört auch die Geschichte: Mit dem Westberliner Benno Ohnesorg lag am 2. Juni 1967 nahe der Deutschen Oper kein sterbender Studierender auf dem Boden. Die Revolte seiner Kommilitonen sollte das Land verändern – gerade weil sie nicht nur Studierende waren, sondern Studenten, die den Unibetrieb eine Zeitlang vernachlässigt haben. Die Partizipialform bezeichnet eine Person, die eine Tätigkeit im Moment ausübt, während das Substantiv „Student“ einen sozialen Status beschreibt.
Nach Jahrzehnten der Debatte gebe es, konstatiert Fabian Payr, keine belastbaren wissenschaftlichen Argumente fürs Gendern. Das betreffe die angebliche Unsichtbarkeit der Frau im Deutschen, die sich weder sprachwissenschaftlich noch mit psycholinguistischen Studien belegen lässt, aber auch die bei Sprachaktivisten verbreitete Überzeugung, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse durch Spracheingriffe verbessern lassen.
In der Praxis habe Gendern keinerlei nachweisbaren Nutzen, im Gegenteil: Gendern sei kontraproduktiv, weil es von vielen als übergriffig und bevormundend empfunden werde. Es betone die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, statt sie zu überwinden. Der Nutzen bestehe vorwiegend in der Signalwirkung: Menschen demonstrieren beim Sprechen und Schreiben ihre politische Zuverlässigkeit. Auf der Ebene der Kommunikation aber wirkt Gendern eher dysfunktional, lenkt es doch vom Wesentlichen ab. Oder, wie schon die Schriftstellerin Nele Pollatschek sagt: Deutschland sei besessen von Genitalien.
Die Diversität der Menschen wird beim Gendern auf ihr biologisches Geschlecht reduziert. Wohin soll das führen? Die soziale Spaltung der Gesellschaft wird durch die sprachliche Teilung doch verstärkt. Sprache wird zum Stigma: Die Elite gendert, redet mit Sternchen im Femininum, während Proleten und Hartz-IV-Empfänger auch in ihren Worten als zurückgeblieben gelten.
Vielleicht sollte es Aufgabe der Medien sein, wenigstens die sprachliche Kluft in der Gesellschaft zu überwinden. Journalisten als Brückenbauer.