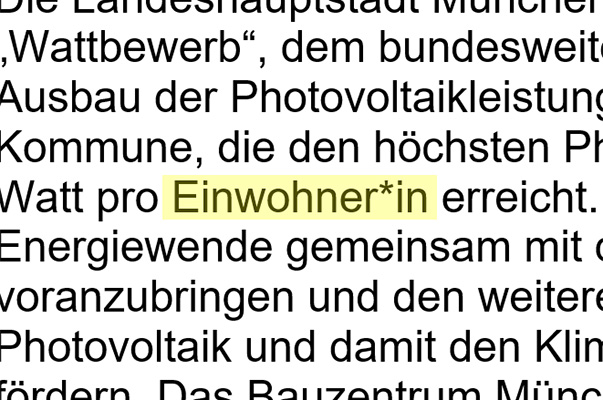
„Ein sperriger Bürokratenjargon“
8. April 2022
Einerseits ist eine große Bevölkerungsmehrheit gegen das Gendern – 86 % bei einer Umfrage des Fernsehmagazins „Galileo“. Andererseits wird es mit großer Leidenschaft praktiziert und eingefordert. Hauptargument: Frauen würden sonst in der Sprache unsichtbar bleiben. Ein erfolgreicher Musiker sieht das jedoch etwas anders und hat darüber ein Buch geschrieben.
Interview mit Fabian Payr
ÖkologiePolitik: Herr Payr, sollen Frauen in der Sprache unsichtbar bleiben?
Fabian Payr: Natürlich nicht. Wenn es der sachliche Zusammenhang erfordert, sollten wir natürlich das Geschlecht einer Person sprachlich kennzeichnen. Die deutsche Sprache ist hierfür übrigens bestens geeignet. Kaum eine andere europäische Sprache macht so intensiv von dem Mittel der „Movierung“ Gebrauch wie das Deutsche. „Movierung“ nennt man in der Sprachwissenschaft das Anfügen spezieller Endungen an die Grundform, etwa die Silbe „-in“ zur Kenntlichmachung des weiblichen Geschlechts. Dadurch wird eine Person eindeutig als weiblich gekennzeichnet. Um Männer sprachlich sichtbar zu machen, müssen sie im Deutschen einen wesentlich größeren Aufwand betreiben, da das Maskulinum spezifisch einen Mann, aber auch generisch eine Person beliebigen Geschlechts bezeichnen kann. Die feministische Sprachkritik behauptet, das traditionelle Deutsch mit seinem generischen Maskulinum würde Frauen in die Unsichtbarkeit drängen. Ich halte diese Erzählung für einen Mythos, der auf einer ideologisch motivierten Fehlinterpretation sprachlicher Strukturen beruht. Das generische Maskulinum macht Frauen nicht unsichtbar – es blendet einfach nur den Aspekt des Geschlechtlichen aus. Bei einem Satz wie „Ärzte sollen sich mehr Zeit für ihre Patienten nehmen“ spielt das Thema Geschlecht keine Rolle. Es geht um Personen, die den Arztberuf ausüben, und ihre Patienten – gleich welchen Geschlechts.
Warum wird gerade im Kulturbereich so viel gegendert?
Das ist eine interessante Frage. Wir können grundsätzlich eine starke Korrelation zwischen politischer Verortung und der Haltung zum Gendern beobachten: Die Befürworter stammen vorwiegend aus dem linken politischen Spektrum, die Kritiker aus dem konservativen. Das zeigt, dass die Einstellung zum Gendern stark ideologisch geprägt ist – beim Pro oder Contra geben nur in den seltensten Fällen sprachwissenschaftliche Überlegungen den Ausschlag. Wenn im Kulturbereich viel gegendert wird, dann spricht das dafür, dass die dortigen Akteure eher im linksliberalen Spektrum zu verorten sind. Dort gehört Gendern mittlerweile einfach zum guten Ton. Interessant ist an dieser Stelle auch die symbolische Funktion „gendersensibler“ Ausdrucksweisen. Wer so spricht, dem geht es auch ums Aussenden von Signalen: Seht, ich verwende diese modernen Sprachformen – etwa den Genderstern – und ordne mich damit dem Lager der Fortschrittlichen zu, das sehr sensibel mit den Themen Diskriminierung und Diversity umgeht. Es ist gleichsam eine Markierung des eigenen politischen Standpunkts. Damit entfernt sich das Sprechen von seiner kommunikativen Kernaufgabe und wird zu einer symbolischen Handlung.
Was hat Sie als Musiker dazu bewogen, ein Buch gegen das Gendern zu schreiben?
Mit meinem Musikersein hat die Entscheidung für dieses Buchprojekt wenig zu tun. Vielleicht ist man als Musiker sensibler für „falsche Töne“ und reagiert deshalb allergischer auf das Herumgebastele an unserer Sprache. Vielleicht spüren Künstler schon auf der ästhetischen Ebene, dass Gendersprache nicht funktioniert und dysfunktional ist. Die ästhetischen Defekte der Gendersprache werden in der Debatte leider viel zu wenig thematisiert. Was uns als gendersensible Sprache angepriesen wird, ist oft nicht mehr als sperriger Bürokratenjargon, von dem man einfach schon aus stilistischen Gründen die Finger lassen sollte. Es ist eher der Germanist in mir, der bei diesem Buch wieder zum Leben erwacht ist – vor meinem Musikstudium habe ich Germanistik und Romanistik studiert und auch abgeschlossen.
Wie waren die Reaktionen auf Ihr Buch?
Ich habe viele Zuschriften von Lesern erhalten – durch die Bank zustimmender Natur. Ein Shitstorm ist ausgeblieben, was vielleicht damit zusammenhängt, dass ich mich um eine sehr sachliche und sprachwissenschaftlich fundierte Darstellung bemüht habe. Polemik habe ich mir weitgehend verkniffen, was bei dem Thema nicht immer leicht war. Das Buch wurde auch von der Presse sehr wohlwollend aufgenommen. Positiv bewertet wurde vor allem seine gute Verständlichkeit – mir war es wichtig, sprachwissenschaftlich fundiert zu schreiben, aber niemanden mit Fachjargon abzuschrecken.
Welcher der von Ihnen vorgebrachten 20 Gründe ist Ihnen der wichtigste?
Mit einem komme ich da leider nicht aus, drei bräuchte ich schon: Ich halte Gendersprache an erster Stelle für nutzlos. Sie hat darüber hinaus das Potenzial, die Gesellschaft zu spalten. Außerdem ist sie in kommunikativer Hinsicht dysfunktional, da sie permanent die Aufmerksamkeit auf den Geschlechtsaspekt lenkt – der aber meist gar nicht relevant ist und von der Kernaussage eines Satzes ablenkt.
Wie läuft es eigentlich in anderen Ländern? Wird da auch gegendert?
Es gibt in anderen Ländern vergleichbare Diskussionen, das betrifft vor allem Sprachen mit einem Genussystem wie z. B. das Französische, Spanische und Italienische. Aus diesen Ländern ist mir aber nicht bekannt, dass man sich derart in das Thema verbeißt, wie das in Deutschland der Fall ist. Was die Sache in Deutschland so unerquicklich macht, ist die Kombination aus deutscher Gründlichkeit mit einer gewissen uns eigenen moralischen Eitelkeit. Spannend ist der Blick nach Schweden, ein ausgesprochen emanzipiertes Land. Dort wird das generische Maskulinum längst nicht so problematisiert wie bei uns, was sicherlich damit zusammenhängt, dass dort movierte Formen wie „Lehrerin“ kaum verwendet werden. Eine schwedische Lehrerin wird darauf bestehen, als „lärare“ – Deutsch: „Lehrer“ – bezeichnet zu werden. Die Bezeichnung „lärarinna“ würde sie in ihrer Berufsehre kränken.
Herr Payr, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Buchtipp
 Fabian Payr
Fabian Payr
Von Menschen und Mensch*innen
20 gute Gründe, mit dem Gendern aufzuhören
Springer, März 2021
172 Seiten, 19.99 Euro
978-3-658-33126-9
Onlinetipps
Interview mit Jürgen von der Lippe
„Ich bezeichne mich als Feminist“
Augsburger Allgemeine, 14.01.2022
www.t1p.de/xakvf
Udo Brandes
„Vermutlich sind Sie auch einfach nur ein konservativer
Zeitgenosse, der zu träge für Veränderungen ist“
NachDenkSeiten, 07.08.2021
www.t1p.de/vi40
Karsten Krampitz
Vergesst Genitalien, baut lieber Brücken
Freitag, 17.07.2021
www.t1p.de/ysg2
Wolfgang Krischke
Die sexualisierte Sprache
FAZ, 21.06.2021
www.t1p.de/ixt5
Ingo Meyer
Das Märchen vom Gendersterntaler
Berliner Zeitung, 15.05.2021
www.t1p.de/kloz9
Alexander Duebbert
Gendergerechte Sprache: Was spricht dafür – was dagegen?
Galileo.tv, 25.03.2021
www.t1p.de/sxzur
Nele Pollatschek
Gendern macht die Diskriminierung nur noch schlimmer
Tagesspiegel, 30.08.2020
www.t1p.de/16ch
Ewa Trutkowski
Vom Gendern zu politischen Rändern
Neue Züricher, 22.07.2020
www.t1p.de/wapj
Peter Eisenberg
Das missbrauchte Geschlecht
Süddeutsche, 02.03.2017
www.t1p.de/efux




